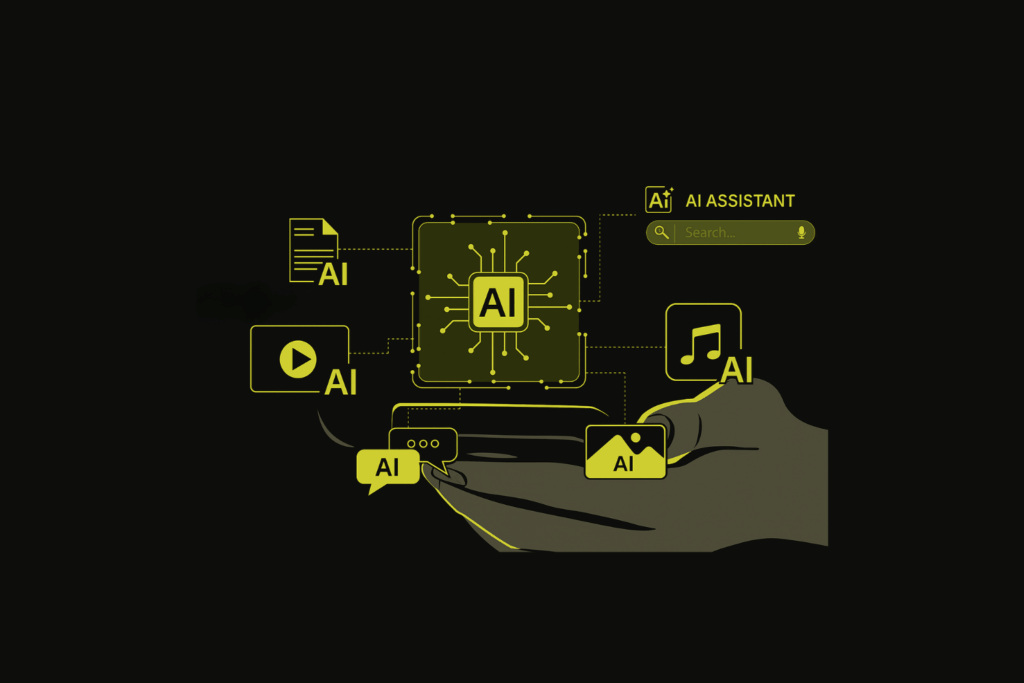Die Idee klingt verlockend: Mit wenigen Klicks einen eigenen Chatbot oder KI-Agenten bauen, der Aufgaben automatisiert, Daten analysiert oder mit Nutzern kommuniziert. Dank sogenannten No-Code Bot-Builder-Tools bzw. Anwendungen, mit denen sich KI-Assistenten und Chatbots oft ganz ohne Programmierkenntnisse per Drag and Drop bauen lassen, ist der Einstieg heute einfacher denn je. Doch wer glaubt, damit sei der Weg zum professionellen KI-Agenten geebnet, unterschätzt oft die technischen und organisatorischen Herausforderungen und riskiert, an den Grenzen der „Do-it-yourself-Ansätze“ zu scheitern. Der folgende Beitrag zeigt praxisnah auf, wann sich der Eigenbau eines Chatbots lohnt und wo die Grenzen des DIY-Ansatzes liegen.
Bevor es an die Umsetzung geht, gilt es zunächst zu klären, was eigentlich hinter einem „echten“ KI-Agenten steckt. Im Gegensatz zu einem klassischen Chatbot oder Voice Assistant kann ein Agent eigenständig handeln und ist oft über entsprechende APIs an Werkzeuge angebunden, um seine Aufgaben zu erfüllen. Ein echter KI-Agent verfügt über:
- LLMs (Large Language Models) wie GPT-5 oder Claude zur Sprachverarbeitung,
- Werkzeuge und Schnittstellen (APIs) zur Ausführung von Aktionen,
- Gedächtnisstrukturen für Kontextbezug und
- eine Autonomie-Logik, die Entscheidungen ohne manuelle Eingaben ermöglicht.
Ein geeignetes Framework zu finden, ist die einzige Anforderung bzgl. der technischen Umsetzung in No-Code-Anwendungen (z.?B. Langflow, BotBuilder, Zapier Chatbots). Oft bieten diese Tools auch an, Dokumente hochzuladen, damit der Assistent spezifische Fragen zum Unternehmen oder bestimmten Prozessen beantworten kann. Zusammen mit Automatisierungstools wie Zapier, n8n oder Make lassen sich die selbst erstellten Assistenten dann auch an Tools anbinden, sodass sie beispielsweise eigenständig E-Mails verschicken oder Kalendereinträge vornehmen können. Diese Anbindungen sind oft innerhalb kürzester Zeit aufgesetzt und sparen dadurch teure Entwicklungskosten.
Grenzen der Selbstbau-Ansätze
Auch wenn No-Code-Tools den Einstieg erleichtern, stoßen sie in vielen Anwendungsszenarien aber dann doch oft an ihre Grenzen, etwa bei:
- Komplexe Schnittstellenintegration: Weichen die Software oder Tools, auf die der Agent zugreifen soll, von Standardprodukten ab, wird schnell klar, dass es oft keine vorhandenen APIs bzw. Schnittstellen gibt, mit denen der Agent kommunizieren könnte. Im besten Fall erfordert es dann umständliche Workarounds, im schlimmsten Fall lässt sich so eine Anbindung nur unter unverhältnismäßig hohen Kosten realisieren.
- Sicherheitsanforderungen: In regulierten Branchen sind DSGVO, ISO-Standards und interne Compliance-Vorgaben zu beachten. Hier kann es ein Ausschlusskriterium sein, unternehmensspezifische Dokumente auf eine der Anbieterplattformen hochzuladen. Auch ist ein eigenes Hosting bei vielen Anbietern nicht möglich, da der Zugriff nur über die Cloud läuft.
- Wartung und Weiterentwicklung: APIs ändern sich, Modelle veralten, Sicherheitslücken entstehen – ohne laufende Pflege wird der Agent schnell zum Risiko. Außerdem haben Anwender bei Drittanbietern keinen Einfluss auf Änderungen. Da kann es sein, dass sich der Agent von heute auf morgen anders verhält, als ursprünglich erstellt.
- Fehlende interne Expertise: Ohne erfahrene Entwicklerinnen und Entwickler droht eine Endlosschleife aus Bugs, Debugging und Frustration.
Praxisbeispiel 1: KI-Sprach-Agent zur Entlastung im Kundenservice
Ein mittelständisches Autohaus wollte den telefonischen Kundenservice entlasten, da die Mitarbeitenden zusätzlich zu ihrer Arbeit im Verkauf und der Werkstatt Telefonanfragen zu Öffnungszeiten und Terminbuchungen beantworten mussten. Mit einem No-Code-Tool hatte ein technisch versierter Mitarbeiter schnell einen Voice-Assistenten aufgesetzt, die Anbindung an die Telefonnummer funktionierte problemlos. Die ersten Tests verliefen vielversprechend: Der Agent konnte einfache Fragen zum Autohaus beantworten und erkannte Kundendaten zuverlässig. Doch als es um die Integration des bestehenden, individuell entwickelten Terminbuchungssystemsging, stieß das Autohaus auf ein Problem: Die Plattform unterstützte keine Schnittstelle zu ihrem System, weder über eine API noch über externe Anbindungen wie Zapier oder Webhooks. Der Sprachagent konnte zwar sprechen, aber keine Termine eintragen, was jedoch die Voraussetzung für eine echte Entlastung gewesen wäre.
Nach mehreren Versuchen und Rücksprachen mit dem Support entschied sich das Autohaus, professionelle Hilfevon einer spezialisierten Agentur in Anspruch zu nehmen. Diese entwickelte eine maßgeschneiderte Lösung, die den KI-Agenten mit dem Terminbuchungssystem verband und das Projekt erfolgreich umsetzen konnte – allerdings mit mehr Aufwand als zunächst geplant.
Praxisbeispiel 2: KI-gestützter Onboarding-Chatbot für ein Maschinenbau-Unternehmen
Ein weiteres Beispiel, das ebenfalls die Grenzen der No-Code-Ansätze aufzeigt, ist das eines Maschinenbauers, der seinen Onboarding-Prozess für neue Angestellte optimieren wollte. Hierfür war geplant, allen neuen Mitarbeitern einen virtuellen Chat-Assistenten als direkten Mentor an die Seite zu stellen, der jederzeit Fragen zum Unternehmen und zu Prozessen beantwortet. Als einfache und schnell umsetzbare Lösung wurde auf ein No-Code Chatbot-Tool zurückgegriffen. Die ersten Tests mit fiktiven Daten liefen gut, und der Chatbot ließ sich auch leicht in das bestehende Wissensmanagement-Tool integrieren. Als es allerdings darum ging, dem Chatbot Unternehmensdaten verfügbar zu machen, war schnell klar, dass viele der dafür benötigten Daten auch vertrauliche Unternehmensinformationen enthielten, die nicht auf externe Server von Drittanbietern wie dem verwendeten Chatbot-Tool hochgeladen werden dürfen. Der No-Code-Ansatz war somit zwar theoretisch gut geeignet, um die Funktionalitäten zu testen, hatte in der Praxis in Bezug auf die strengen Datenschutzanforderungen aber keinen Bestand.
Wann lohnt sich der Eigenbau – und wann nicht?
Ein selbst gebauter Agent oder Chatbot kann sinnvoll sein, wenn:
- er einfache Fragen zum Unternehmen beantworten soll,
- kommerzielle und weit verbreitete Tools mit entsprechenden Schnittstellen angebunden werden sollen,
- keine unternehmenskritischen Daten in die Cloud des Drittanbieters hochgeladen werden müssen,
- Self-Hosting nicht unbedingt notwendig ist,
- nur ein kleines Budget zur Verfügung steht und
- gleichzeitig interne IT-Expertise vorhanden ist.
Sobald jedoch hohe Sicherheitsanforderungen, komplexe Integrationen oder Skalierungsfragen ins Spiel kommen, ist die Umsetzung durch einen professionellen IT-Dienstleister nicht nur empfehlenswert – sondern oft unverzichtbar.
Fazit: Professionelle Chatbots brauchen professionelle Umsetzung
Die Demokratisierung von KI-Technologien ist ein Fortschritt – aber kein Freifahrtschein für den Eigenbau komplexer Agentensysteme. Wer langfristig stabile, sichere und skalierbare Lösungen haben möchte, sollte frühzeitig auf das Know-how spezialisierter IT-Experten setzen. Denn ein einfacher Chatbot ist schnell gebaut. Für viele Anwendungsgebiete bedarf es aber meist mehr.
Hier gehts zum vollständigen Artikel